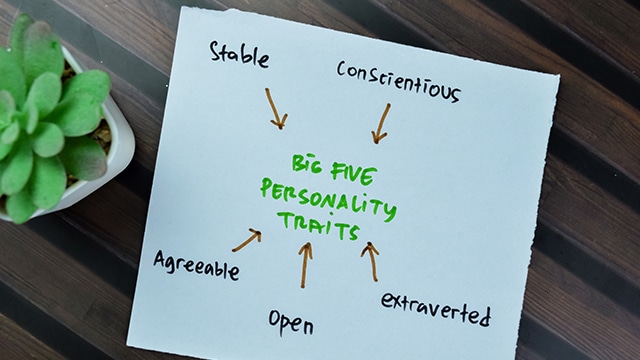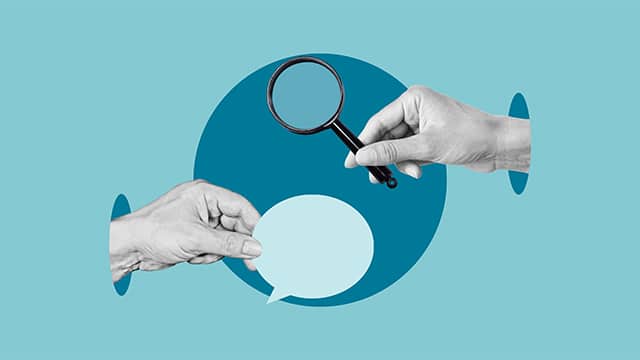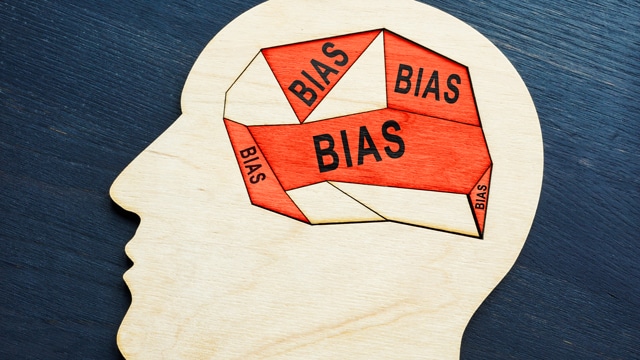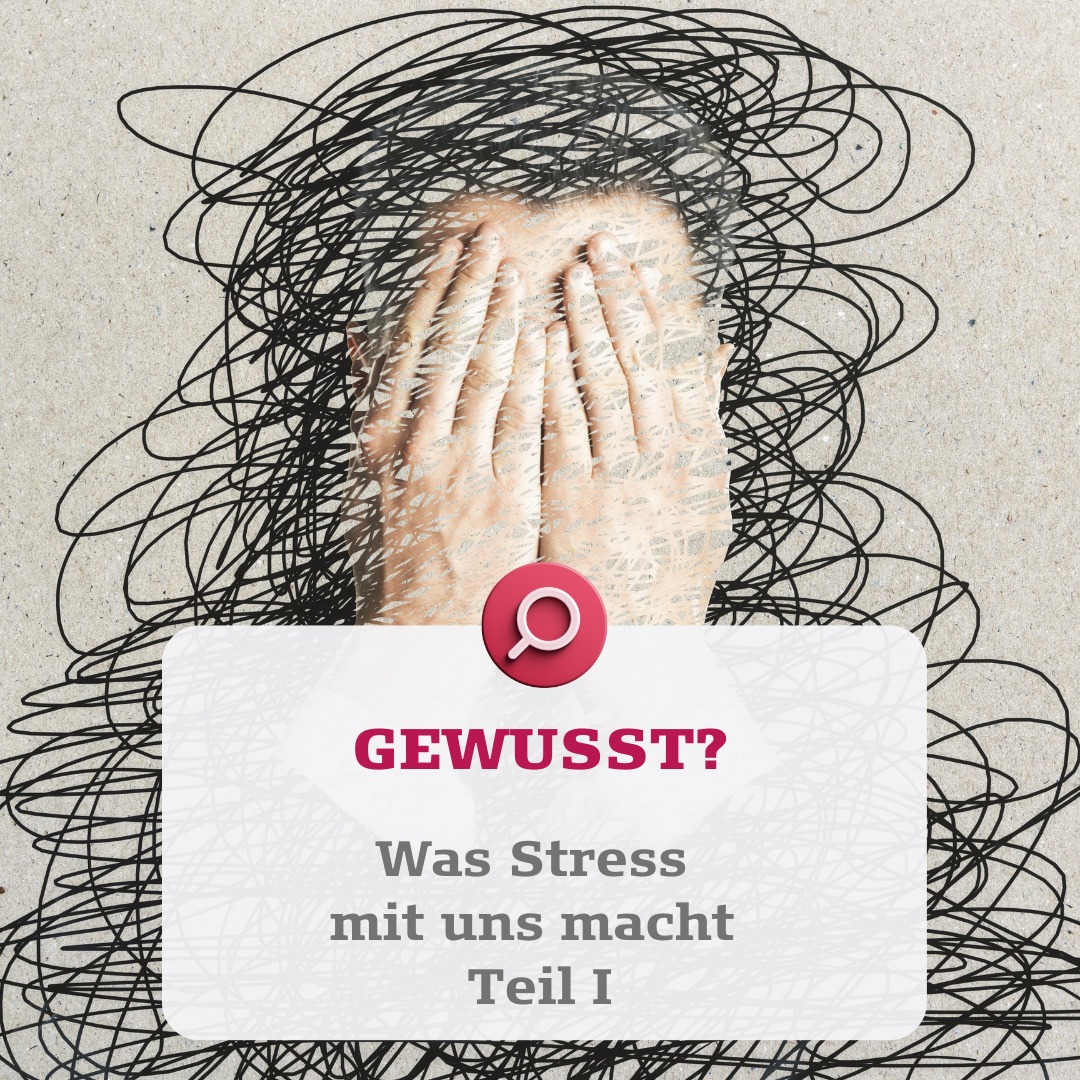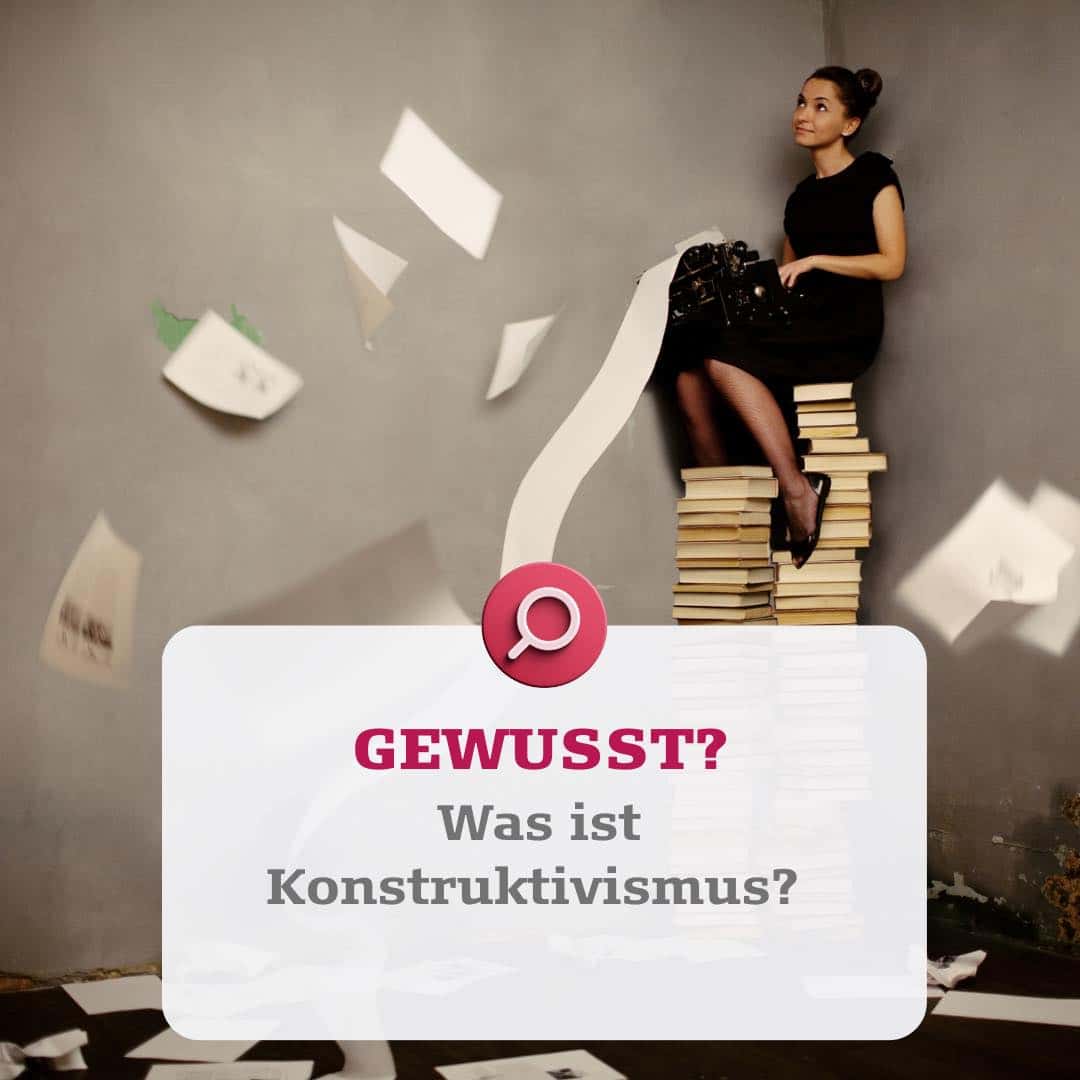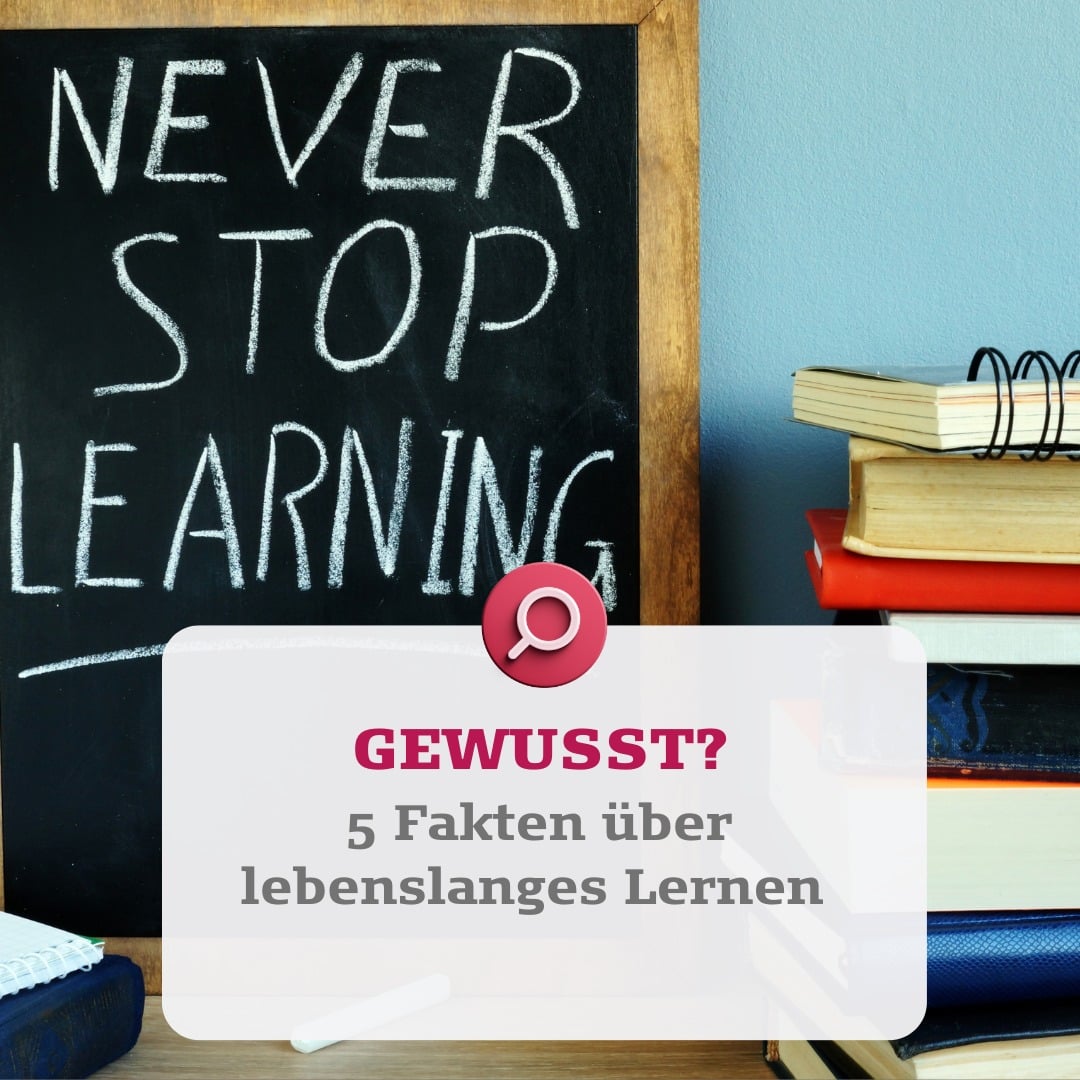Zwischen Heilung und Hysterie

Wie Coaching der „Übertherapisierung“ unserer Gesellschaft entkommen kann
Mentale Gesundheit ist vom Flüsterton in die Öffentlichkeit getreten. Psychotherapie wird auf Instagram empfohlen wie ein neuer Lieblingsort, Coaching hat sein Luxus-Image abgestreift und ist Werkzeug des Alltags geworden. „An sich arbeiten“ gilt als Tugend, nicht als Makel. Was einst hinter verschlossenen Türen stattfand, wird heute in Podcasts verhandelt, in Bestsellern systematisiert und am Abendbrottisch besprochen.
Doch in diesem Fortschritt birgt auch Fallstricke: Das Streben nach Optimierung lässt normale Unsicherheiten wie Defizite erscheinen – und jedes vermeintliche Defizit ruft nach professioneller Intervention. Zwischen echter Hilfe und einer Kultur der Dauerreparatur ist die Linie dünn geworden. Ein kurzer Blick zurück klärt, wie wir hierherkamen. Ende des 19. Jahrhunderts etabliert Wilhelm Wundt in Leipzig das erste psychologische Labor: Messen statt meinen. Fast zeitgleich öffnet Sigmund Freud die Tür zu einem inneren Theater – die Psychoanalyse erzählt von Trieben, Konflikten, Deutungen. Zwei Stränge entstehen: die Psychologie als empirische Wissenschaft und die Psychoanalyse als Deutungs- und Behandlungssystem. Im 20. Jahrhundert rückt der Behaviorismus das Beobachtbare in den Mittelpunkt; später bringt die „kognitive Wende“ Denken und Wahrnehmen zurück ins Labor. Daraus erwachsen moderne Verfahren wie die kognitive Verhaltenstherapie – überprüfbar, schrittweise, wirksam.
Die Geschichte kennt aber auch ihre dunklen Zimmer. „Hysterie“ wurde als Frauenkrankheit etikettiert, begleitete ein Jahrhundert lang das Bild der unzuverlässigen, überreizten Seele – ein misogynes Narrativ mit langer Halbwertszeit. In den 1930er bis 1950er Jahren galt die Lobotomie mancherorts als Fortschritt: Metallinstrumente, teils über die Augenhöhle, sollten die Seele beruhigen – eine Praxis, für die es Preise und Applaus gab, bevor sie als Verstümmelung erkannt und geächtet wurde. Homosexualität stand bis in die 1970er Jahre in Diagnosekatalogen. Wer heute von „der Wissenschaft“ spricht, sollte wissen: Sie ist lernfähig – und fehlbar.
Parallel entstand eine zweite genealogische Linie, aus der Coaching viel gelernt hat: die humanistische Psychologie und die Lösungs- und Ressourcenorientierung. Statt Defizite zu verwalten, fragt man nach Möglichkeiten. In den 1970ern zeigte der Sport die Wirksamkeit dieses Blicks: Timothy Gallweys „Inner Game“ brachte die Idee in die Breite, dass Weiterentwicklung aus Aufmerksamkeit, nicht aus Selbstkritik erwächst. In den 1990ern formte die Positive Psychologie die nüchterne Frage: Was macht Menschen belastbar? Hoffnung, Sinn, Beziehungen – Coaching hat hier seine Heimat: Zukunft gestalten, Potenziale heben, Verantwortung stärken. Kein Ersatz für Therapie, sondern ein anderes Format: weniger Diagnose, mehr Dialog; weniger Krankheitsgeschichte, mehr Zielbildung.
Warum also das Unbehagen heute? Weil ein wachsender Markt an Versprechen entstanden ist. Algorithmen belohnen Einfachheit – und einfache Wahrheiten verkaufen sich gut. Darin gedeihen selbsternannte Gurus, die „den Mann retten“ wollen: Sie versprechen Halt in verunsicherten Zeiten, indem sie zu rigiden Rollenbildern zurückkehren („Gefühle sind Schwäche“, „Härte statt Verletzlichkeit“) und so Trauer, Angst oder Überforderung als Wehleidigkeit pathologisieren oder praktisch verbieten. In ähnlicher Weise etabliert sich eine Anti-„woke“-Rhetorik, die Empathie, Diversität oder Traumawissen als Ideologie rahmt – Begriffe wie „Trigger“, „Selbstfürsorge“ oder „Scham“ werden abgewertet, statt differenziert verstanden. Parallel entstehen Coaching-Angebote, die Therapie imitieren, ohne deren Standards zu erfüllen: Sie verwenden therapeutische Labels („Trauma-Heilung“, „Inneres Kind“) oder arbeiten mit Diagnosen, jedoch ohne anerkannte Ausbildung, Supervision, Schweigepflicht und Krisenpläne. Beispielhaft sind „Trauma-Release-Sessions“ per Videocall mit impliziten Heilversprechen oder eine „Narzissmus-Therapie“ als Vier-Wochen-Kurs – beides ohne therapeutische Zulassung. Und natürlich gibt es Influencer-Psychologie, die komplexe Störungsbilder in 30 Sekunden erklärt – ohne Kontext, Differentialdiagnostik oder Hinweis auf Grenzen. Das ist nicht nur problematisch, es ist verführerisch: Es stiftet Zugehörigkeit, bietet klare Feindbilder und schnelle Erleichterung. Dorthin zieht es Menschen, wo seriöse Hilfe zu langsam wirkt, zu differenziert spricht oder zu schwer zugänglich ist.
Gleichzeitig erleben wir eine Überdiagnostizierung: Aus Erschöpfung wird „Burnout“, aus Temperament „ADHS“, aus Traurigkeit „Depression“. Manchmal trifft das zu – oft aber übersetzt es Leben in Etiketten. Diagnosen können Türen öffnen und Leid benennen. Sie können aber auch Identität verengen – oder paradoxerweise Identität stiften. So sprechen eine Wissenschaftler schon von „Identitären Diagnosen“. Coaching ist hier nicht die Lösung, aber ein Korrektiv: ein Raum, der ohne Krankheitsbegriff auskommt, ohne den Schmerz zu verneinen; der Verantwortung stärkt, ohne Selbstüberforderung zu glorifizieren.
Worauf kommt es an? Auf Klarheit der Grenzen. Therapie, wenn Leid, Risiko oder Vergangenheit im Zentrum stehen. Coaching, wenn Ziele, Rollen, Entscheidungen und Handlungsfähigkeit gefragt sind. Beides braucht Ethik, Transparenz, Supervision – und die Demut, weiterzuverweisen, wenn das eigene Format nicht passt. Das gilt ausdrücklich in beide Richtungen: Coaches in die Psychotherapie, wenn es um Klinisches geht – und Therapeuten ins Coaching, wenn die Themen nicht (mehr) krankheitswertig sind, sondern Umsetzung, Rollenklärung und performatives Handeln. Dass das im therapeutischen Selbstverständnis nicht immer leicht ist, liegt in der Logik der Profession: Diagnostik ordnet, kann aber auch problemzentrieren und damit pathologisieren; zugleich zielt der Behandlungsauftrag darauf, das erkannte Problem im eigenen Setting zu lösen. Professionell ist darum, Indikation und Grenzen fortlaufend zu prüfen – und Übergänge aktiv zu gestalten. Und beides braucht eine Sprache, die Menschen nicht klein macht: keine Heilsversprechen, aber auch keine Schreckensdiagnosen. Vielleicht ist das die eigentliche Aufgabe unserer Zeit: die Errungenschaften der Psychologie zu bewahren, ihre Irrwege zu erinnern – und Coaching als erwachsene Praxis zu etablieren, die nicht die Seele repariert, sondern Verantwortlichkeit, Sinn und Handlungsspielräume kultiviert. Nicht mehr „immer an uns arbeiten“, sondern wieder lernen, gut zu leben: mit Ambivalenz, mit Grenzen, mit Mut zur Entwicklung.
Mut zur Entwicklung bedeutet nicht, jede Regung der Seele sofort zu optimieren. Er beginnt oft damit, etwas auszuhalten, zu unterscheiden und erst dann zu handeln. Unsere Großeltern kannten Phasen der Erschöpfung, der Traurigkeit, des Rückzugs – sie gaben ihnen selten klinische Namen. Das war nicht „besser“; es war eine andere Schwelle, Krisen als Teil des Lebens zu akzeptieren. Die Kehrseite: Vieles blieb ungesagt, unversorgt, beschämt. Die Ressource: eine gewisse Vertrautheit mit Unwetter, ohne es jedes Mal zur Katastrophe zu erklären.
Heute neigen wir dazu, jedes emotionale Tief sofort zu behandeln. Damit riskieren wir, jene psychologischen „Immunkräfte“ zu verlernen, die Resilienz ausmachen: Ambivalenz ertragen, Spannungen regulieren, aus Erfahrungen Bedeutung ziehen. In der Psychologie spricht man von „Stressinokulation“: kleinere Belastungen bewältigen, um für größere gerüstet zu sein. So wie ein Muskel nicht ohne Reiz wächst, erweitert sich auch unser „Fenster der Toleranz“ nicht ohne dosierte Zumutung.
Wer allerdings jedes Unwetter sofort in den sicheren Hafen professioneller Hilfe umlenkt, übt seltener, selbst zu steuern. Nicht, weil Hilfe schlecht wäre – im Gegenteil. Sondern, weil Selbstwirksamkeit eine Praxis ist. Sie entsteht, wenn wir erst prüfen: Liegt akute Gefahr, Suizidalität, massiver Funktionsverlust oder ein anhaltendes Leiden vor – dann gehört das in ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung. Oder handelt es sich um belastenden, aber normalen Schmerz – Überforderung, Kränkung, Entscheidungsangst? Dann genügen oft Halt im Umfeld, ein entlastendes Gespräch, eine Pause, manchmal Coaching. Psychotherapeutische Intervention meint mehr als „reden“: strukturierte Diagnostik, Risikoabschätzung, methodisches Vorgehen nach Leitlinien und ein verabredetes Setting mit Ziel und Verlaufskontrolle. Diese Unterscheidung ist kein Heroismus, sondern Hygiene: Sie verhindert, dass wir das Normale pathologisieren und das Pathologische verharmlosen.
Dahinter stehen zwei Leitfragen: Was kann und darf ich aushalten, um Resilienz aufzubauen – ohne jedes Wehwehchen zur Störung zu erklären? Auf welches Hilfsangebot greife ich zurück, wenn ich Unterstützung brauche – auf Therapie (entlastend, aber mit notwendiger Pathologisierung) oder auf Coaching (Selbstverantwortung betonend, aber mit einer klaren Grenze, wo Selbstverantwortung nicht mehr trägt)? Die Techniken beider Felder überschneiden sich weitgehend; der Unterschied liegt im Auftrag, in der Indikation und im Setting. Qualität zeigt sich daran, wie klar diese Grenze gezogen und respektiert wird. Wenn wir so vorgehen, gewinnen wir beides: die Würde, Leid ernst zu nehmen – und die Freiheit, nicht jedes Lebenstief zur Diagnose zu machen. Resilienz ist dann keine Härteparole, sondern eine Kulturtechnik: die Fähigkeit, Stürme zu lesen, Segel zu setzen, Hilfe zu rufen, wenn es nötig ist – und ansonsten das Steuer in der Hand zu behalten.
Neurowissenschaftlich spricht vieles dafür, dass bereits das strukturierte Nachdenken über ein Problem – gebündelt durch präzise Fragen – messbare Effekte hat: Alarmnetzwerke beruhigen sich, exekutive Steuerung wird stärker, Perspektivwechsel wird leichter. In Bildgebungsstudien zeigt sich dieses Muster als geringere Stressreaktivität und als stärkere Einbindung präfrontaler Kontrollsysteme; sobald konkrete Optionen sichtbar werden, reagiert zudem das Belohnungssystem – Motivation wird wahrscheinlicher, nicht nur behauptet. Gute Coaches nutzen diese Mechanik der Aufmerksamkeit und Sprache, ohne therapeutische Verfahren zu imitieren: Sie sortieren, schärfen Bedeutungen, öffnen Handlungsspielräume.
Das kann überraschend heilsam wirken – nicht, weil Coaching Krankheiten heilt, sondern weil es Ressourcen organisiert. Der Fokus verschiebt sich weg von „Was fehlt?“ hin zu „Was ist da – und wie nutze ich es?“. Wer eigene Möglichkeiten erkennt und in kleine, machbare Schritte übersetzt, erlebt oft eine reale Entlastung. In der Praxis heißt das: präzise benennen, klug rahmen, konkret entscheiden. Fragen wie „Woran würden Sie merken, dass es ein Stück besser ist?“, „Welche Ausnahmen vom Problem gab es bereits?“ oder „Was ist der kleinstmögliche nächste Schritt?“ verschieben den Blick vom Defizit zur Wirkung. So entsteht Momentum – nicht als Euphorie, sondern als verlässliche, kleine Vorwärtsbewegung. Genau hier liegt die Stärke von Coaching: Es greift nicht in klinische Tiefen, sondern in die Architektur des Alltags. Es übersetzt Einsicht in Umsetzung, schützt vor der Konsequenz einer selbst gewählten Verantwortungslosigkeit– aber: lässt genug Reibung, damit Lernen stattfindet. Darum gehört Coaching nicht nur ins Vorstandsbüro, sondern ebenso an den Küchentisch, in Projektmeetings, in Schule und Ehrenamt: Es ist persönlich – und wirkt doch überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten und zusammenleben. Gutes Coaching schöpft aus Philosophie (Urteil, Ethik), Psychologie (Wahrnehmung, Motivation), Soziologie (Rollen, Macht), Pädagogik (Lernen), aus Sprache und Kunst (Bilder, Metaphern, Ausdruck) – und, wo es passt, aus Glaubens- und Sinnfragen.